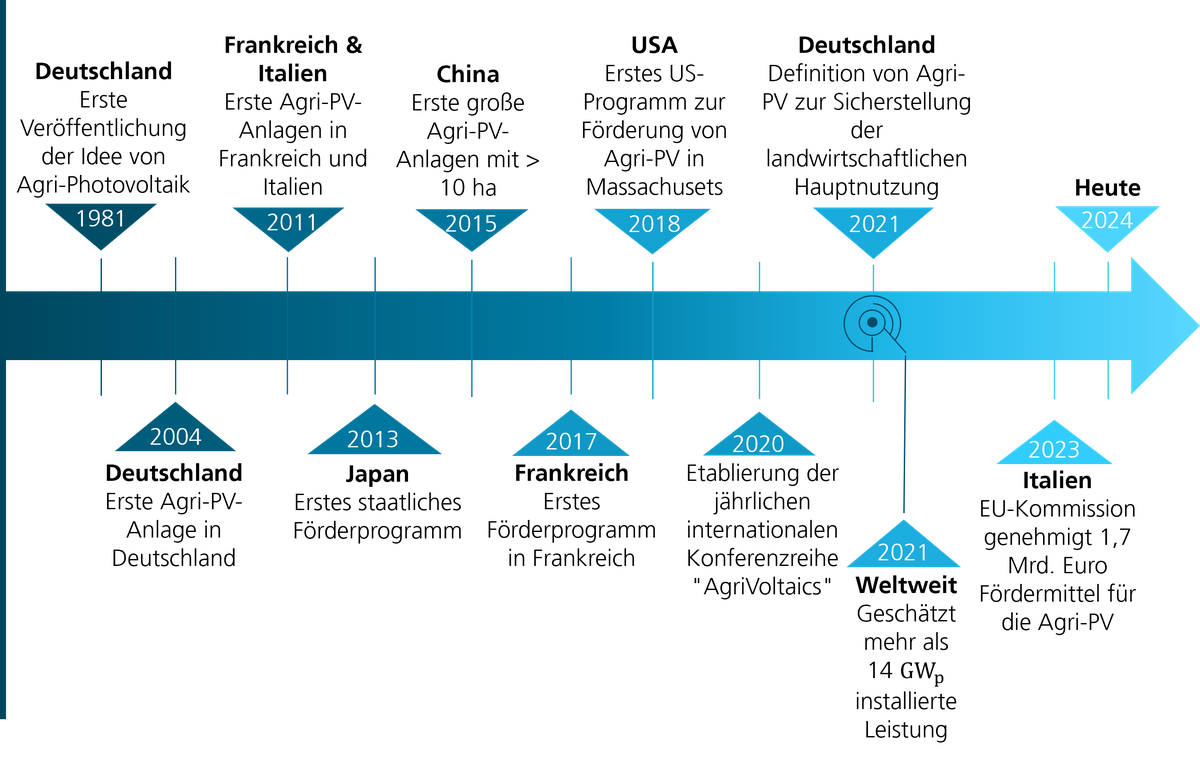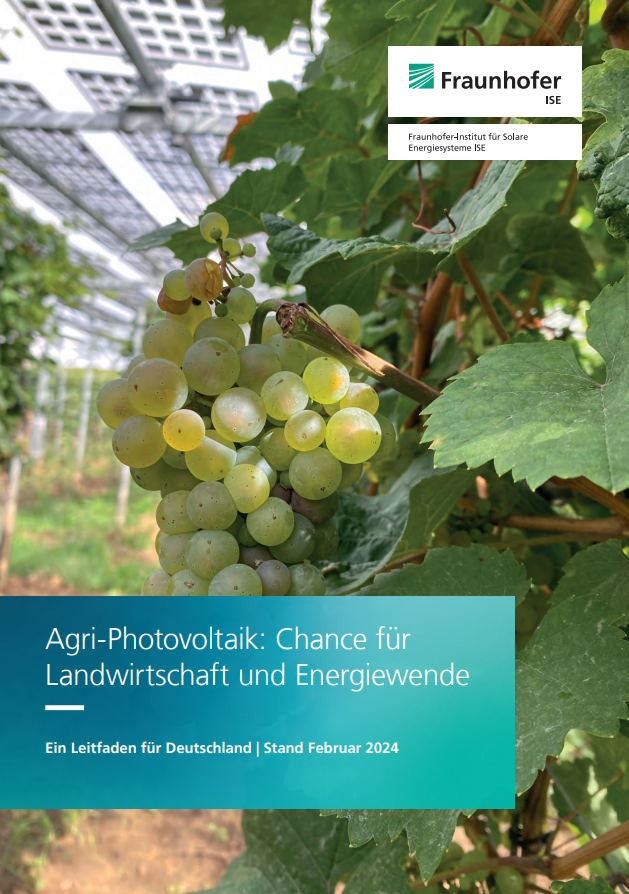Bei Sonderkulturen, wie dem Obst-, Gemüse- und Weinanbau ist der gesteigerte Nutzen (Ernteerträge und Resilienz) besonders hoch, da diese Kulturen besonders anfällig für Hagel-, Frost- und Dürreschäden sind und durch die Teil-Überdachung mit Solar-Modulen vor solchen Witterungsschäden besser geschützt werden. Beispiele sind im Projekt »Modellregion Agri-PV Baden-Württemberg« zu finden. Zudem sind die Synergie-Effekte bei Sonderkulturen stärker ausgeprägt, weshalb der Nutzen besonders hoch ist.
Schattentolerante Kulturen, wie Blatt- oder Fruchtgemüse, oder Feldfutterarten (z. B. Kleegras) eignen sich ebenfalls sehr gut.
Ackerbauliche Kulturen unter Agri-PV sind besonders in trockenen Gebieten gut geeignet. In Heggelbach nahe dem Bodensee wurden in heißen Jahren gute Ergebnisse bei Winterweizen, Gerste, Roggen, Triticale, Kartoffeln, Sellerie und Kleegras erzielt, in niederschlagsreichen Jahren betrugen die Ertragseinbußen bis zu 20 Prozent.